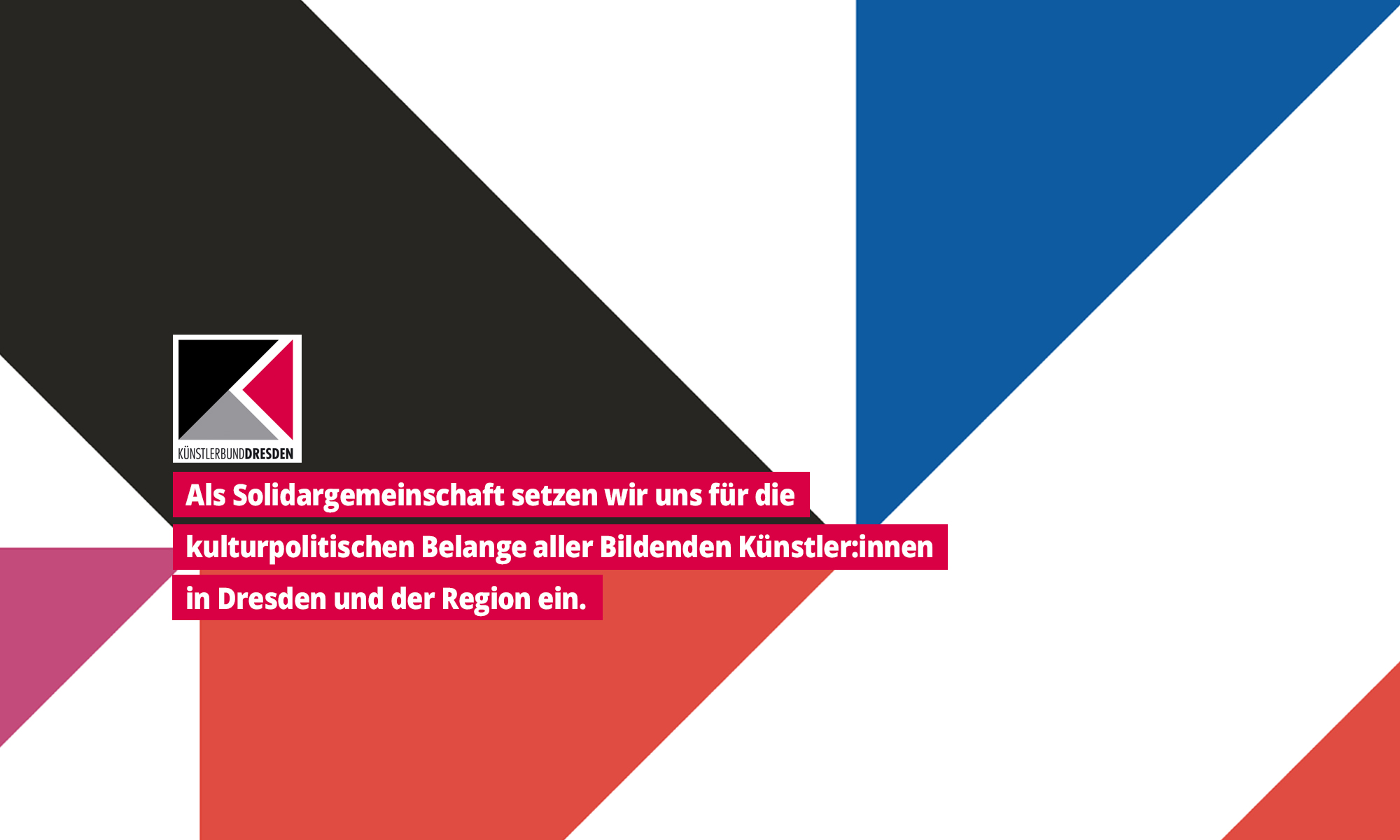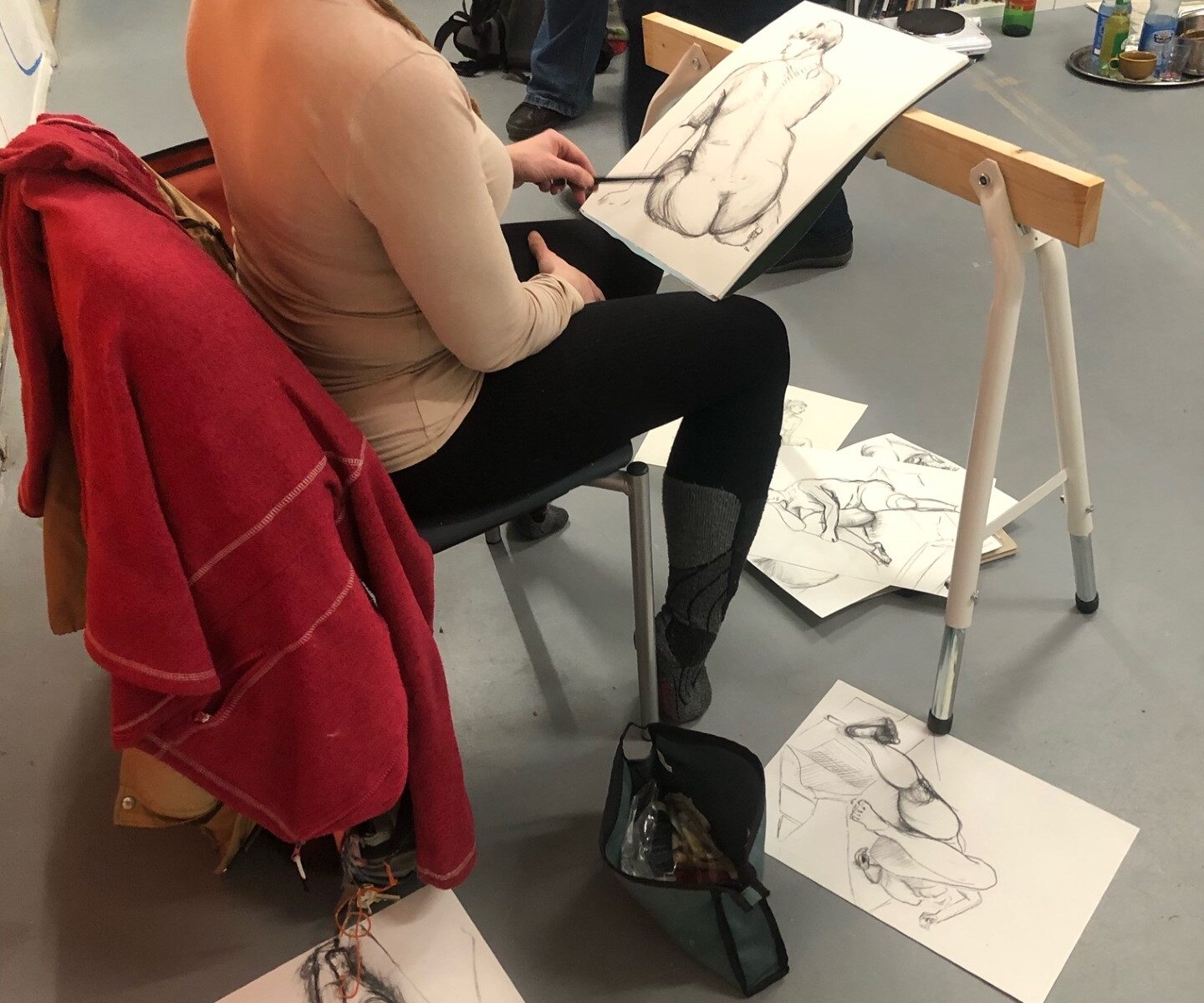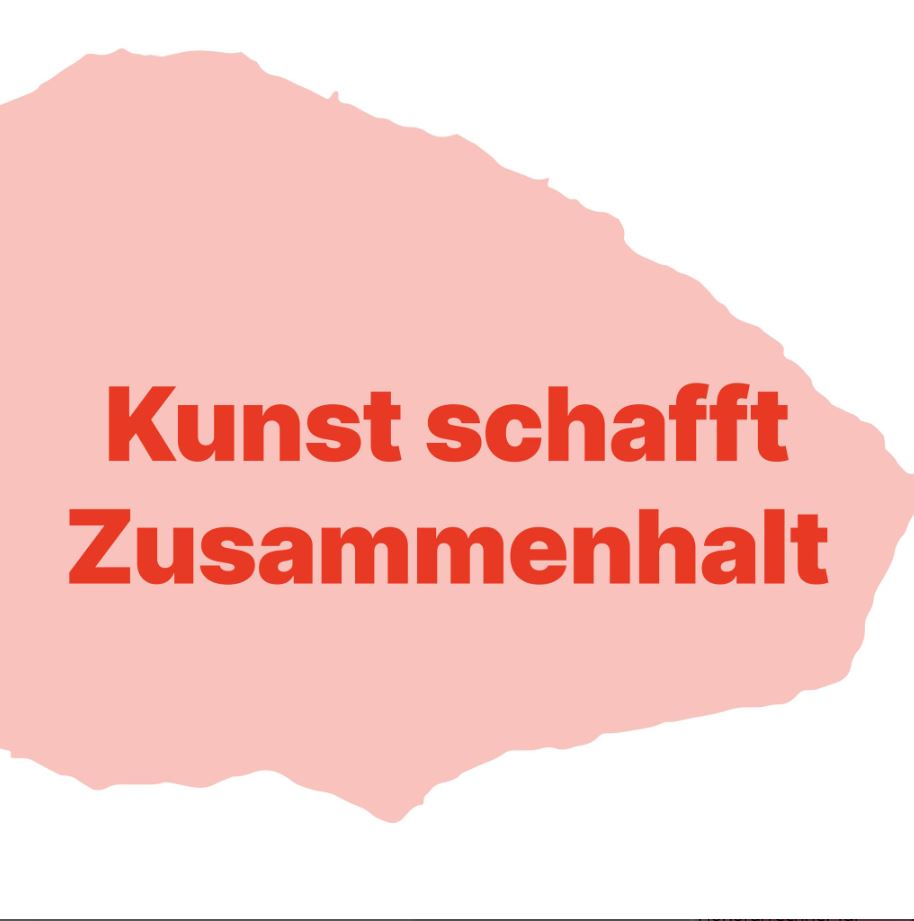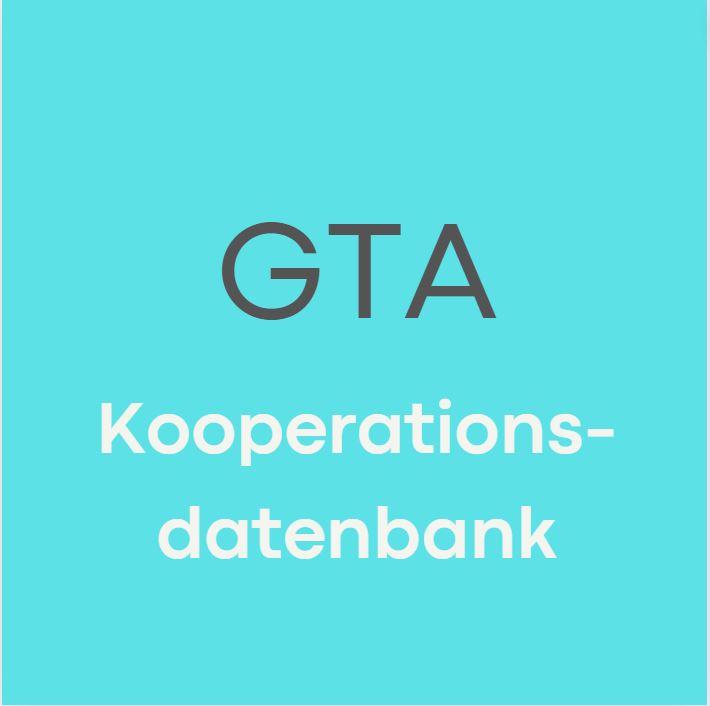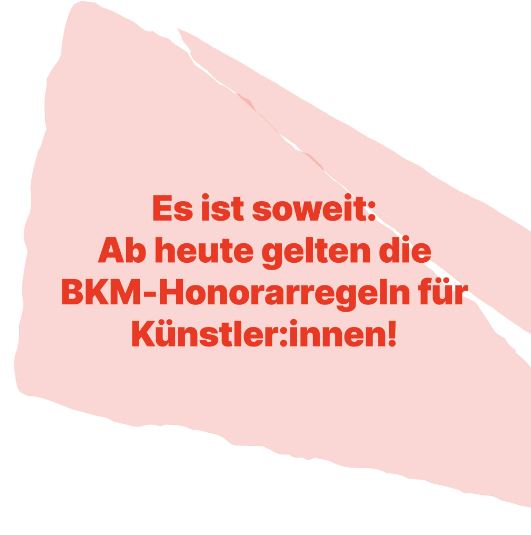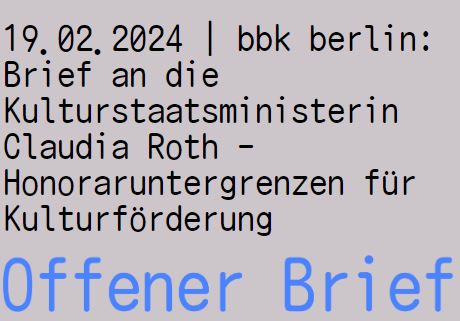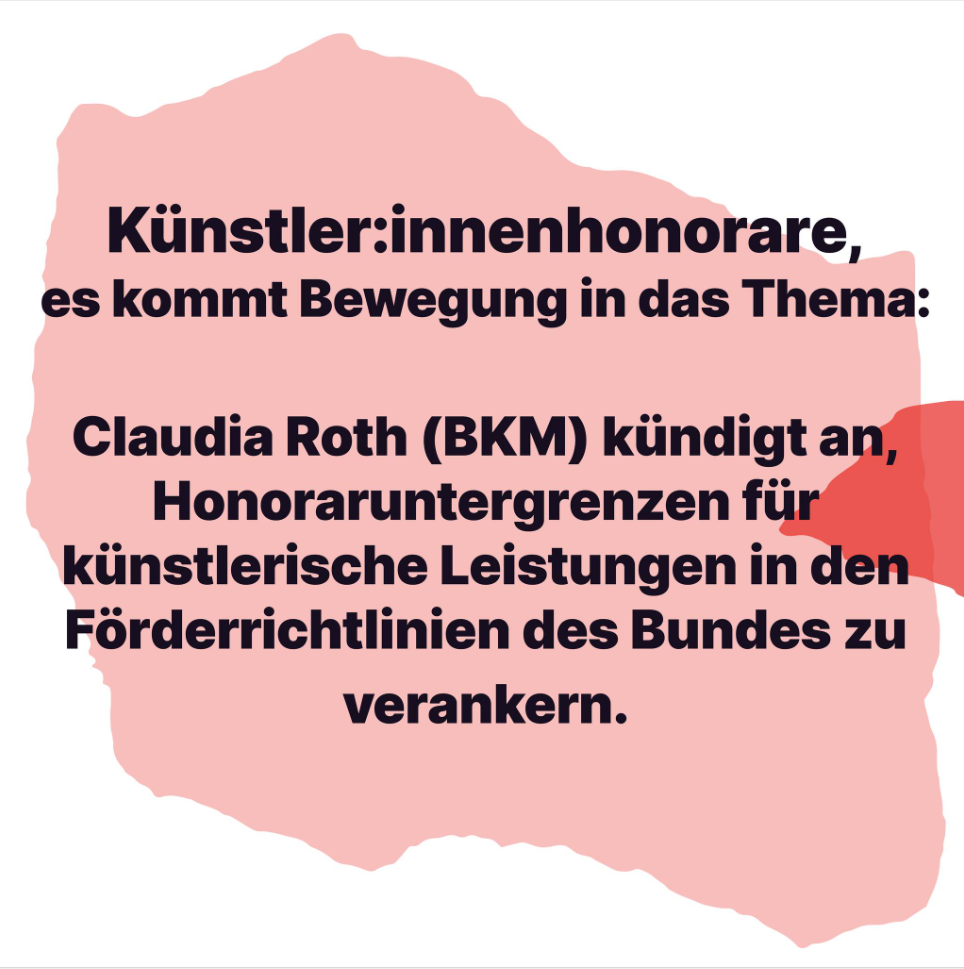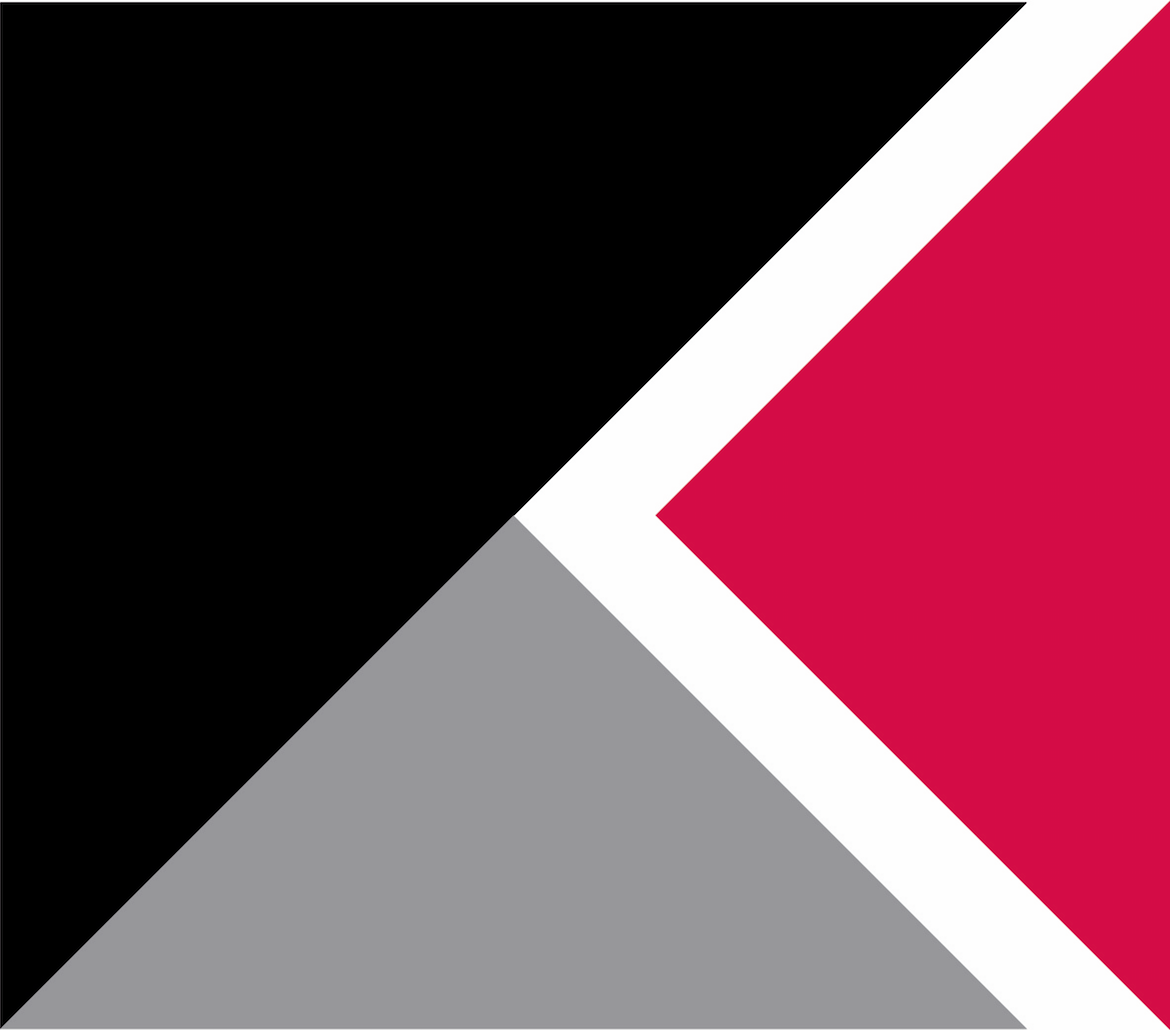Sie existiert bereits seit 2019 und doch ist die „Werkdatenbank Bildende Kunst Sachsen“ (WBKS) vielen noch gar kein Begriff. Dabei wird sie seither kontinuierlich gefördert. Susanne Magister, die immer am ersten Dienstag im Monat in unseren Räumen Beratungsgespräche anbietet, bringt uns auf den allerneuesten Stand.
KBD: Die WBKS gilt als Pionierleistung, da sie bundesweit das erste Projekt war, in dem künstlerische Werkbestände von Künstler:innen und Nachlasshalter:innen selbst erfasst und gebündelt präsentiert werden können.
Susanne Magister: Richtig. Der jetzt vorliegenden WBKS liegt eine Vorläuferversion zugrunde, die angedockt an die „Künstlernachlässe Berlin/Brandenburg“ an die sächsischen Bedürfnisse angepasst war. Aus der heraus konnte dann, seit 2016, und in Kooperation mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB), die WBKS entwickelt werden. Eine große Fördersumme des SMWKT hat das möglich gemacht. Der Prototyp wurde 2019 vorgestellt und wird sukzessive und sachsenweit weiterentwickelt, d.h. die Verbände in Chemnitz, Dresden und Leipzig arbeiten gemeinsam daran.
KBD: Wie ist der aktuelle Stand?
SM: Mittlerweile sind insgesamt 26.000 Werke eingestellt, knapp 170 Künstler:innen sind angemeldet, online sichtbar sind davon etwas über 100.
Um die Struktur der Datenbank noch genauer zu erklären: Jede Person hat die Chance, eigene Werke in beliebiger Zahl einzustellen. Wir empfehlen immer einen Kernbestand. Im zweiten Schritt kann er/sie entscheiden, welche der Arbeiten wirklich öffentlich zugänglich sein sollen. Ein großer Mehrwert ist schließlich auch die seit 2022 Stück für Stück erfolgende Weitergabe der Werkdatensätze in Verbundnetzwerke (Deutsche Fotothek, arthistoricum.net, Deutsche Digitale Bibliothek (DDB sowie Europeana), was die Sichtbarkeit der sächsischen Kunstschaffenden weiter erhöht.
KBD: Das Wichtigste zur Werkdatenbank in Kürze: Susanne, was ist das Hauptanliegen des Projekts?
SM: Zum einen und allem voran ist sie ein Handwerkszeug für die einzelne Künstler:innen, die sich mit ihrer Eingabe eine digitale Werkdatenbank online und in beliebiger Größe sichern kann. Darüber hinaus ist damit nicht nur die Sichtbarkeit einzelner gesichert, sondern insgesamt erscheint die WBKS dann auch als ein Schaufenster für die sächsische Kunst.
Außerdem dient die WBKS auch als Recherche- und Netzwerktool für Kunstwissenschaftler, Galeristen oder Museumsmitarbeiter. Die haben die Möglichkeit mit einer sehr komplexen Verschlagwortung, sei es nach Themen, Medien, Materialien und verschiedenen anderen Kriterien zu suchen. Wir sind hier beständig dabei zu erweitern. Das ist die Ausgabeseite, die mindestens genauso wichtig ist.
KBD: Du bist 2019 eingestiegen. Inzwischen hast du schon wieviel Beratungen durchgeführt?
SM: Seit ich 2019 eingestiegen bin, gibt es dieses monatliche Angebot, sich dienstags im Künstlerbund beraten zu lassen. Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, telefonisch nochmal nachzuhaken oder auch überhaupt telefonisch oder per Mail Dinge zu klären. Es werden schon so um die 100 Beratungsgespräche sein, die ich inzwischen geführt habe. Viel Zeit nimmt die Betreuung der Nachlässe ein, wo wir dann vor Ort auch über längere Zeit und ganz intensiv zusammenarbeiten.
KBD: Und hier müsst ihr beständig um die weitere Finanzierung bangen.
SM: Die gute Nachricht zuerst: Zum Glück ist die Langzeitarchivierung und technische Betreuung der Datenbank selbst dauerhaft über die SLUB gegeben. Es besteht also kein Anlass zur Sorge, dass die einmal hochgeladenen Daten dann nicht mehr abrufbar sind.
Was aber die für uns so wichtige Anlaufstelle für Beratungen und in bestimmten Fällen auch konkrete Unterstützungsleistungen z.B. bzgl. der Digitalisierung von Datenbeständen anbetrifft, hier ist die personelle Situation zumindest für die nächsten beiden Jahre gesichert.
Denn, obwohl bereits Tutorials entwickelt wurden und auch ein Handbuch im Entstehen begriffen ist, ersetzt das nicht die persönliche Beratung und Hilfestellung. Im ein oder anderen Fall ist das persönliche Gespräch dann doch der entscheidende Anstoß, sich zu registrieren und die eigenen Daten hochzuladen oder sich überhaupt mit dem Thema Nachlass zu beschäftigen
Sie ist allerdings abhängig von der Haushaltsplanung des Freistaates Sachsen, sodass wir hier immer wieder gegenüber den Regierungsparteien vermitteln müssen, wie wichtig digitale Instrumente und eine digitale Entsprechung für die Vermittlung von zeitgenössischer künstlerischer Arbeit ist. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion um die Erhaltung der physischen Werke.
KBD: Aktuell wird die WBKS noch einmal erweitert. Was steht gerade an?
SM: Der LBK ist tatsächlich sehr umtriebig, neue Fördertöpfe aufzutun. Gerade eben wird die Datenbank auf diese Weise um eine digitale Ausstellung erweitert und damit nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Es entsteht hier eine 3D-Ausstellungsplattform, die es den Künstlern perspektivisch ermöglicht, selbst eine eigene Ausstellung zu kuratieren. Genauso können gemeinsam mit dem LBK thematische Ausstellungen generiert werden. Die erlauben es digitalen Besuchern, einen digitalen Ausstellungsraum zu betreten.
KBD: Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik?
SM: Das ist Zukunftsmusik, aber heiß am Entwickeln – das kommt in diesem Jahr! Hierfür konnten Mittel aus dem Förderprogramm KulturErhalt des SMWKT gewonnen werden, welches ausdrücklich zur Resilienzstärkung und Entwicklung digitaler Konzepte im Kulturbereich aufgelegt wurde.
KBD: Es entsteht also keine Doppelung, sondern wirklich etwas Neues?
SM: Ja, denn es ist wirklich eine andere Sache, ob man sich Kunst flach in der Werkdatenbank abruft oder durch einen digitalen Raum geht. Außerdem ermöglicht es Künstlern, sich niedrigschwellig eine eigene virtuelle Ausstellung zu erstellen und damit dann auch in Schließ-, Pandemie- oder anderen Ausfallszeiten zumindest online präsent zu sein.
KBD: Diese Räume werden dann auch richtig gestaltet sein?
SM: Es wird sich schon um einen vorgegebenen Show-Room handeln, der aber ähnlich wie im realen Ausstellungsraum Möglichkeiten bietet, Wandflächen farbig zu gestalten oder Stellwände einzubringen.
Eine weitere Idee dabei ist auch, die Werkdatenbank nochmal anders erfahrbar zu machen. Über die Verschlagwortung ist es möglich nach Themen wie bspw. Akt, Engel, Pleinair, digitale Gruppen-Ausstellungen umzusetzen.
KBD: Letzte Frage: Können auch Audios und Videos eingebunden werden?
SM: Leider nein, aktuell geht das noch gar nicht, aber die Programmierer:innen arbeiten derzeit daran. Hier wird noch nach Lösungen gesucht, weil es problematisch ist, Hunderte Megabyte große Dateien aufzunehmen. Auch eine Verlinkung auf andere Plattformen wie Vimeo oder YouTube ist nicht wirklich zufriedenstellend.
Interview und Foto: Christine Gruler
Kurzinfos hier