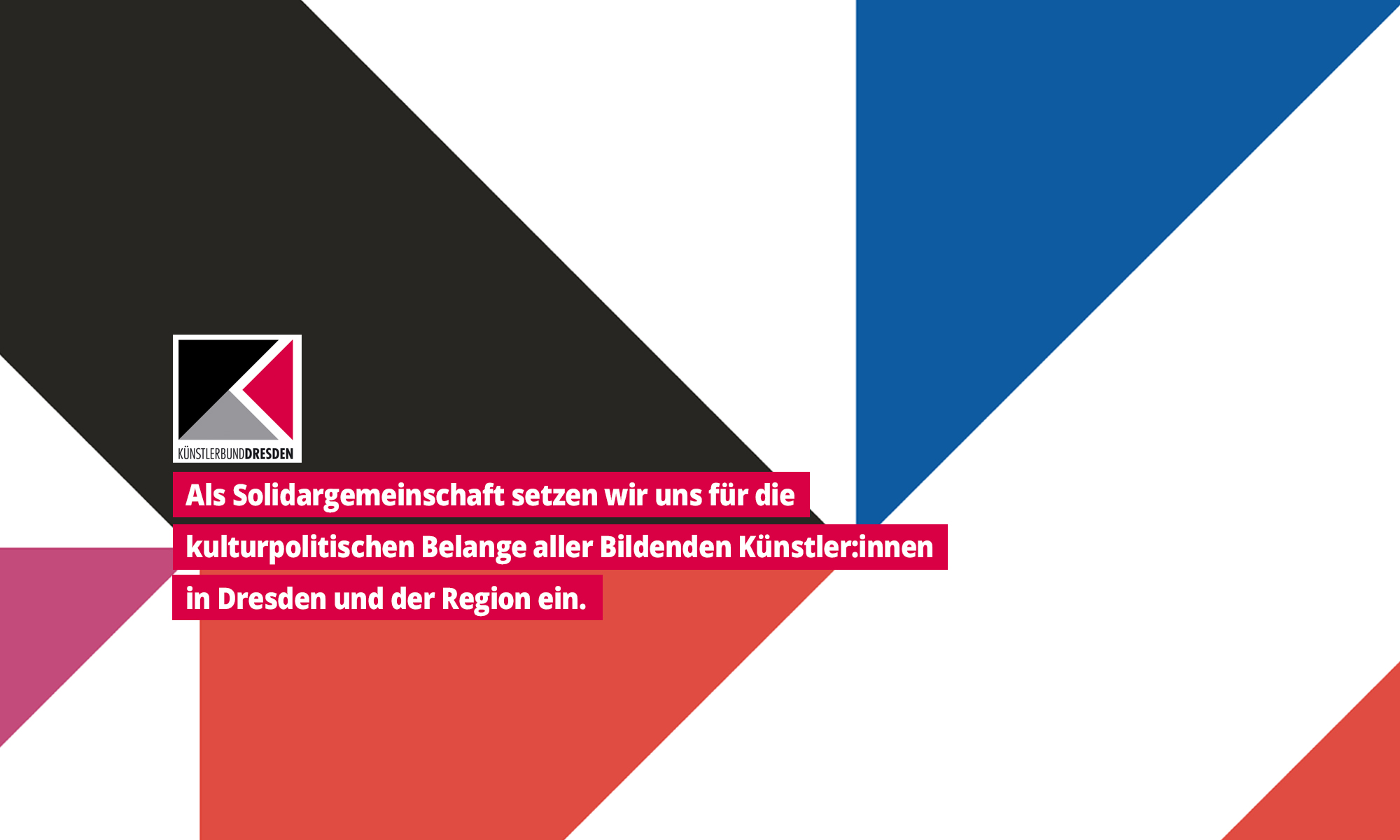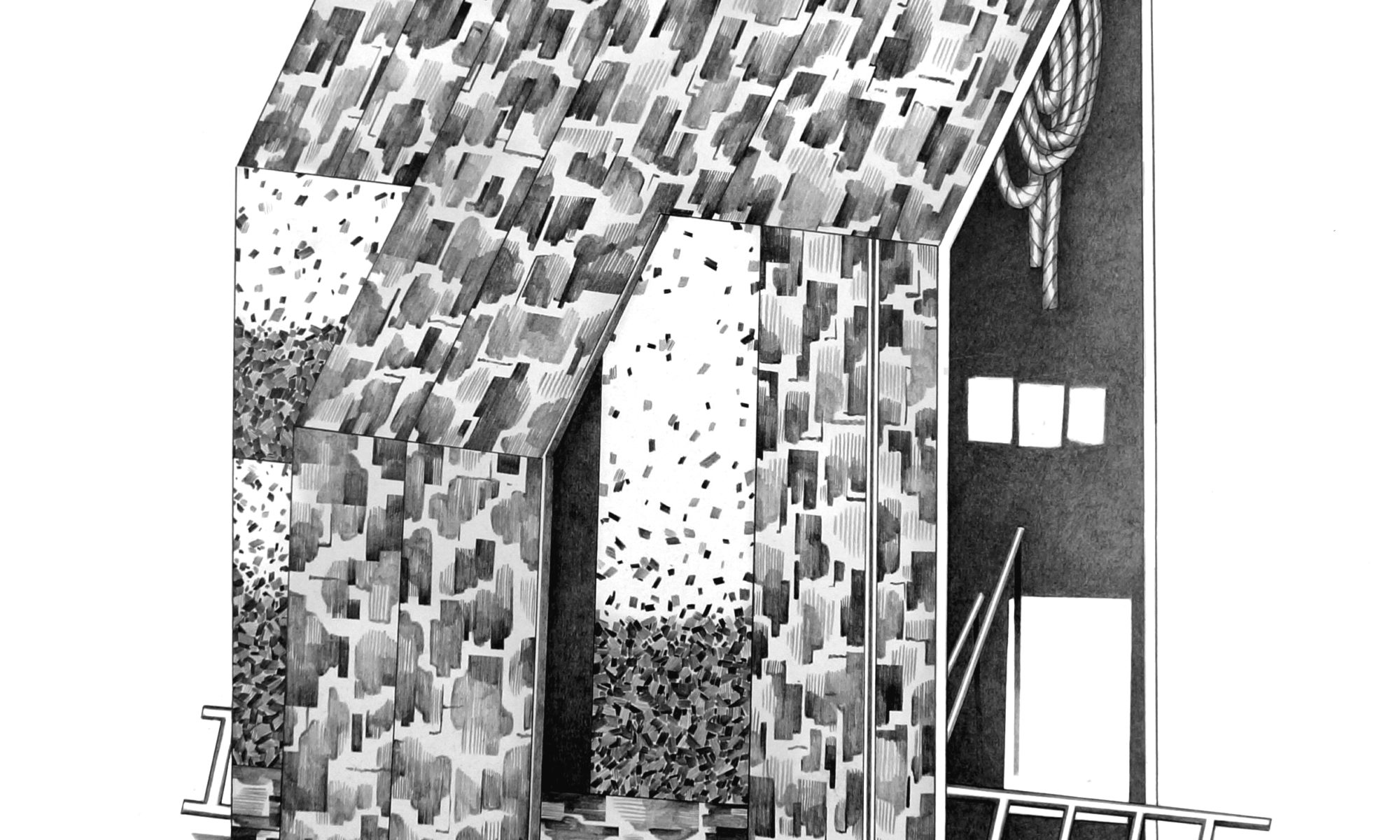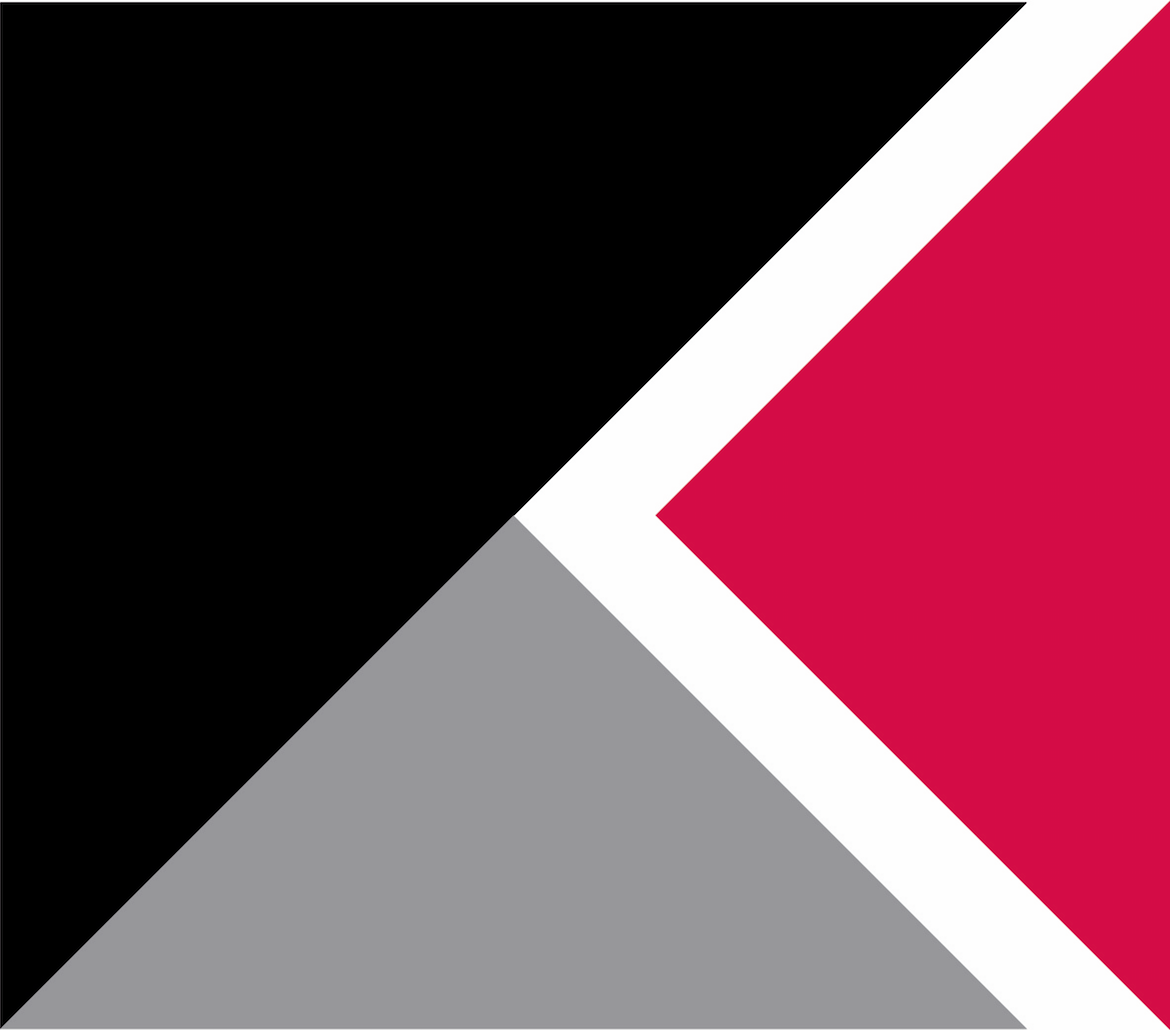Dresden steht vor der Wahl der neuen Stadtspitze. Am 12. Juni entscheiden die Wähler über die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister. Die DNN haben Akteure aus der Gesellschaft befragt, welche Erwartungen sie an das nächste Stadtoberhaupt haben. Heute: Torsten Rommel, Geschäftsführer des Künstlerbundes Dresden und Sprecher für die Bildende Kunst im Netzwerk Kultur Dresden, einem Zusammenschluss der freien Szene.
DNN: Dem Blick voraus will ich einen Blick zurück voranstellen. Welches Fazit gibt es zu den vergangenen Jahren mit OB Dirk Hilbert, mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und dem Stadtrat aus Sicht des Künstlerbundes? Was hat sich getan, was nicht?
Torsten Rommel: Die Arbeit von Frau Klepsch wird von vielen Akteuren der Kunst- und Kulturschaffenden wertgeschätzt, insbesondere auch innerhalb der freien Szene. Sie ist interessiert an unserer Arbeit und engagiert, die notwendigen Verbesserungen unserer Rahmenbedingungen anzuschieben. Ihr vorgelegtes Konzeptpapier „Fair in Dresden 2025“ nimmt Forderungen des Netzwerks Kultur auf und sieht eine sinnvolle Anpassung von Förderinstrumenten und Budgets der Kulturförderung an die Entwicklung der freien Kulturszene vor.
Zudem hat sich insgesamt in unserer Kommunalpolitik bezüglich der Anerkennung und Wahrnehmung der Kultur und Kreativwirtschaft viel getan. Die Wirtschaftsförderung ist entsprechend ausgestaltet worden, die Kreativraumförderung verstetigt. In der Vergangenheit jedoch, und das kritisiere ich, wurde der Fokus der Förderung von Kultur und Kreativwirtschaft stetig stärker auf die Kreativwirtschaft gesetzt, also auf Aspekte wie Dienstleistungen, Produktentwicklung, Unternehmertum,
Arbeitsplätze, Gewerbesteuern.
DNN: Klassische Wirtschaftsförderung also.
TR: Genau – und das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Aber was in der Förderung zunehmend aus dem Blick gerät, sind die Themen der intrinsisch motivierten Kunst und Kultur. Hier sehen wir zukünftig eine Menge Gestaltungs- und Investitionsbedarf. Und so fehlt es immer noch an einem ausreichenden politischen Handeln bezüglich Atelier- und Probenräumen, insbesondere für die Musik und die Bildende Kunst in Dresden.
Die Trennung zwischen Kultur und Kreativwirtschaft ist nicht nur, aber eben auch in Dresden immer stärker aufgehoben worden. Gerade in der Pandemie, als Freizeit- und Kultureinrichtungen im Rahmen von Schließungsverordnungen auf eine Ebene gestellt wurden, hat sich das überdeutlich gezeigt. Dies berücksichtigt jedoch nicht, dass es sich dabei um zwei Branchen mit ganz unterschiedlichen Zielen, Aufgabenstellungen sowie Arbeitsprozessen und Rahmenbedingungen handelt.
DNN: Wie ist das zukünftige Stadtoberhaupt hier gefordert?
TR: Vor allem geht es darum, die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine Stadtgesellschaft zu verstehen und dieses Verständnis in politisches Handeln zu integrieren. So kommen dann auch Themenfelder wie Verkehrswende, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität oder die neuen Fragen unserer
Energieversorgung ins Spiel. Schließlich haben sich Künstler und Kreative schon immer mit Veränderungsprozessen beschäftigt und arbeiten kollaborativ. Sie können in solche stadtgesellschaftlichen Prozesse viel stärker eingebunden werden. Da ist in Dresden deutlich Luft nach oben. Hier holt sich die Stadt anfangs zwar oft Input, aber der spätere Austausch zu den Themen kann und muss klar besser werden.
DNN: Gibt es da Beispiele?
TR: Nehmen wir den aktuellen Kulturentwicklungsplan der Stadt. Da gab es zu Beginn auch Einbindungen der freien Szene. Gespräche wurden geführt, Eingaben wurden gemacht, dann entschied sich jedoch auf anderen Ebenen, was nun final drinsteht und was nicht. Ein weiterer oder fortführender Dialog war in diesem Prozess nicht vorgesehen. Auch im Rahmen der Kulturhauptstadt-Bewerbung 2025 (Dresden scheiterte 2019 in der ersten Runde, T.K.) verlief es nach dem gleichen Muster. Die große Überschrift damals war „Partizipation und Beteiligung“. Was dabei rauskam, war dramatisch muss man sagen. Trotz großem Engagement bei der inhaltlichen Ausrichtung, mit zahlreichen Projektvorschlägen seitens der Kulturszene und der Stadtgesellschaft insgesamt, entstand daraus eine Bewerbung mit Kunst und Kultur als Vehikel einer Strategie fürs Stadtmarketing.
Jüngstes Beispiel ist dann der Alte Leipziger Bahnhof. Dort gibt es einen Beteiligungsprozess, aber dafür viel zu kleine Zeitfenster der Rückkopplung in eine breitere Stadtgesellschaft. Man hat die Fläche lange vor sich hinvegetieren lassen, und nun muss alles plötzlich ganz schnell gehen. Die dort seit Jahren angesiedelten Atelier- und Kunstorte Hanse 3 und Blaue
Fabrik nicht nur zu erhalten, sondern als maßgeblichen Impulsgeber für die weitere Entwicklung des nord-östlichen Bereichs des Areals zu setzen, ist wesentlich. Die Stadt muss mehr und bessere Möglichkeiten bieten, Leute mittun zu lassen. Das gelingt nicht so gut – und das ist frustrierend.
DNN: „Starke Wirtschaft“ ist das Mantra des amtierenden OB. Mir fehlt aber eine Idee – von Vision gar nicht zu reden -, wo diese Stadt in ihrer Selbstwahrnehmung hin will. Stichwörter: Stadtteile, Ghettoisierung, Gentrifizierung, soziale Durchmischung. Wenn ich schaue, wo welche Baulücken in Dresden wie geschlossen werden, steigt mein Puls. Ich sehe oft eine phantasielose Zukleisterung von Stadt und öffentlichem Raum. Für eine freie Kulturszene bleibt so natürlich ebenfalls kein Spot übrig. Und Potenzial wird in Dresden ganz oft rein monetär verstanden.
TR: Diese Politik ist überholt, davon müssen wir uns einfach verabschieden. Politischer Wille zur Transformation lässt sich auch daran festmachen, welche Bereitschaft da ist, bezahlbare Atelier- und Arbeitsräume für Kultur und Kreativwirtschaft zu halten oder zu schaffen. Da sind wir in Dresden ganz weit hinten. Bis vor ein paar Jahren gab es immer noch ein paar Räume und
Leerstände, da kümmerten sich die Künstler selbst. Aber der Zug ist lange abgefahren, die Kommune muss sich engagieren.
Jetzt ist ein grundlegendes Umdenken notwendig, in dem Kunst und Kultur nicht als Solitär neben der Stadtgesellschaft stehen. Sie müssen mitten in die elementaren gesellschaftlichen Prozesse eingebunden sein. Das haben wir in den letzten Jahren nicht geschafft, das muss man so festhalten.
DNN: Wo klemmt es denn genau?
TR: Ich denke, es klemmt daran, dass zum einen Beteiligung und Partizipation professionalisierter umgesetzt werden müssen. Dann brauchen die Entscheidungsträger in der Verwaltung die notwendige politische Unterstützung für solche Prozesse, deren Ausgang zu Beginn noch unklar und offen ist. Womöglich existiert auch eine gewisse Furcht in den
Verwaltungsstrukturen vor Mehrarbeit.
DNN: Heißt, die Verwaltung bleibt lieber unter sich?
Das heißt, dass die Verwaltung vielleicht mit ihrer aktuellen Personalausstattung hier überfordert ist. Auch diese Strukturen müssten verbessert werden. Der große Wunsch der Kunst- und Kulturschaffenden in Dresden ist jedenfalls der nach Teilhabe auf Augenhöhe. Für die Stadt hieße das, diese Leute vollumfänglich einzubinden und sie nicht irgendwo Konzepte stricken zu lassen, um Inputs zu liefern und sie dann auf halber Strecke zurückzulassen.
Vieles steht und fällt damit, ob man die Kultur-Akteure als essenziell wichtig für die Stadtentwicklung sieht. Entsprechende Teilhabe müsste der OB dann über die Fachbereiche des Rathauses einfordern. Eine Vielzahl an künstlerischer Arbeit geschieht in Selbstausbeutung. Grundlage für Teilhabe der Kulturschaffenden ist jedoch, dass sie nicht permanent um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen, um sich überhaupt in solche Prozesse einbringen zu können. Applaus ist keine Währung. Sowohl die vom Kulturamt auf den Weg gebrachte „Charta der Nachhaltigkeit im Kultursektor“, die unter anderem soziale Nachhaltigkeit als Zielmarke setzt, wie auch die neu gestaltete Kulturförderrichtlinie sind wichtige Vorgaben, um eine faire Bezahlung im Kulturbereich zu erreichen. Ein zukünftiger OB sollte das erkennen und seinerseits entsprechende Vorgaben machen, um die von Verwaltung und Stadtrat richtigen und wichtigen Ansprüche des
Kultursektors in die Haushaltsplanungen einfließen zu lassen.
DNN: Eine Richtlinie ist aber wenig verbindlich.
Realistisch wäre es deshalb, sich Zielmarken zu setzen. Also nicht zu sagen, das wäre schön, aber wir haben das Geld nicht und verharren im Stillstand. Sondern zu sagen: Wir haben es jetzt nicht, aber verpflichten uns verbindlich über Entwicklungsschritte, in ein paar Jahren einen bestimmten Status zu erreichen. Da würde ich ein Stadtoberhaupt in der Pflicht sehen. Dass bei einem konstanten Kulturhaushalt und aufgrund steigender Personalkosten von Tariflöhnen in kommunalen Häusern Mittelkürzungen bei der freien Szene die Folge wären, hielte ich für eine grundfalsche und fatale Entwicklung.
DNN: Die jüngsten Entwicklungen wie der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Mehrausgaben, auch für Kommunen, bieten natürlich generell ein gutes Gegenargument. Erst mal den Gürtel enger schnallen…
TR: Klar wird das kommen. Da sind wir dann wieder beim Thema, an welcher Stelle gespart werden soll. Da kommunale Ausgaben für Kunst und Kultur eben Investitionen in die Entwicklung und Transformationsfähigkeit unserer Stadtgesellschaft sind und nicht bloß Kosten für die „schönen Künste“, sollte nicht da gespart werden, wo der Gürtel ohnehin schon zu eng ist.
Da haben wir noch gar nicht von der sogenannten Subkultur gesprochen. Wie sieht es denn dort aus?
Wie haben ja zum Glück eine ganz starke Subkultur in der Stadt, die wohl auch aufgrund einer bürgerlichen Verkrustung sehr lebendig ist. Den Akteuren entsprechende Räume, Freiräume anzubieten, auch sie stärker zu fördern und zu unterstützen, bleibt ein Dauerthema. Und apropos Raum: Die Robotron-Kantine soll die Stadt als Ausstellungsort sichern, aus der Interimsnutzung durch das Kunsthaus heraus eine Dauernutzung ermöglichen. Die Stadt braucht das Kunsthaus und das Kunsthaus die Stadt. Genau an diesem Ort.
Interview DNN, 09.06.2022: Torsten Klaus
Applaus_ist_keine_Währung